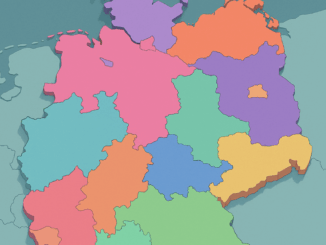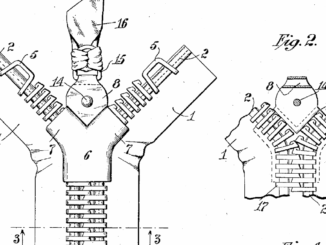Was ist der Unterschied zwischen einer wortsinngemäßen und einer äquivalenten Benutzung bzw. Verletzung eines Patents? Wie wird eine äquivalente Benutzung geprüft?
Wortsinn und Äquivalenz
Bereits in dem Blogbeitrag „Verletzen wir dieses Patent?“ sind wir der Frage nachgegangen auf welche Weise man ein Patent benutzen kann, um es zu verletzen. Hier wurde zwischen der wortsinngemäßen und der äquivalenten Benutzung eines Patents unterschieden. Beide Benutzungsformen werden sukzessive geprüft. Grundlage dieser Prüfung sind die Merkmale in den unabhängigen Ansprüchen des Patents zu deren Auslegung die Beschreibung und die Figuren heranzuziehen sind.
Den vorliegenden Blogbeitrag können Sie sich auch in unserem
Podcast Patent, Marke & Co. anhören.
Prüfung auf wortsinngemäße Benutzung
Wir erinnern uns: Bei der Untersuchung, ob eine wortsinngemäße Benutzung eines Patents vorliegt, wird der unabhängige Patentanspruch, also zumindest der Anspruch 1, Merkmal für Merkmal mit den Merkmalen des konkret benutzten Gegenstands verglichen. Sollten im Patentanspruch beispielsweise die Merkmale A, B und C genannt sein, so ist zu prüfen, ob die genannten Merkmale auch in dem konkreten Produkt realisiert sind. Dabei ist es unerheblich, ob das Produkt weitere Merkmale, beispielsweise D und E, aufweist. Solange sich alle Merkmale A, B und C in der konkreten Benutzungsform wiederfinden, muss von einer wortsinngemäßen Benutzung des Patents, mithin einer Verletzung ausgegangen werden. Eine Prüfung auf eine äquivalente Benutzung ist bei Feststellung einer gegebenen wortsinngemäßen Benutzung in der Regel entbehrlich.
Prüfung auf äquivalente Benutzung
Sollte man bei der Prüfung wortsinngemäßer Benutzung zu dem Ergebnis gelangen, dass ein Merkmal des Patentanspruchs zwar nicht wörtlich, aber durch ein abgewandeltes Merkmal realisiert ist, sollte eine Prüfung auf äquivalente Benutzung erfolgen. Um bei dem vorstehend genannten abstrakten Beispiel zu bleiben: Wenn an Stelle des Merkmals C im Patentanspruch ein Merkmal C‘ in dem verwendeten Produkt zur Anwendung kommt, das zwar nicht dem Wortsinn des Merkmals C unterfällt, jedoch als Äquivalent betrachtet werden kann, sollte eine Äquivalenzprüfung erfolgen.
In diesem Zusammenhang hat sich im deutschen Recht durch höchstrichterliche Rechtsprechung ein Prüfungsschema für die äquivalente Benutzung herausgebildet. Dieses geht unter anderem auf die sogenannten Schneidmesser-Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zurück. Schneidmesser-Entscheidung, weil es in dem Patent um ein rotierendes Schneidmesser zum Schneiden von Papier ging. So müssen drei Voraussetzungen gegeben sein, um von einer äquivalenten Benutzung des Patents sprechen zu können, nämlich Gleichwirkung, Naheliegen und Gleichwertigkeit.
Das 3-stufige Prüfungsschema
Bei dem Prüfungspunkt „Gleichwirkung“ wird untersucht, ob das im Patentanspruch genannte Merkmale objektiv gleichwirkend wie das abgewandelte Merkmal des benutzten Gegenstands ist. Um ein plattes Beispiel zu bemühen: Der Patentanspruch nennt einen Schweißpunkt zum Verbinden zweier Bauteile. Demgegenüber ist in dem Produkt ein Niet zum Verbinden der beiden Bauteile genannt. Beide Lösungen erzielen die gleiche vom Patent gewünschte Wirkung, nämlich eine Verbindung der beiden Bauteile. Somit darf in diesem Fall – objektiv betrachtet – von einer Gleichwirkung von Schweißpunkt und Niet ausgegangen werden.
Während die „Gleichwirkung“ noch relativ einfach festzustellen ist, wird es bei der Prüfung auf ein „Naheliegen“ des gegenüber dem Merkmal im Patentanspruch abgewandelten Merkmals in der konkreten Ausführungsform bereits schwieriger. Dabei muss das abgewandelte Merkmal durch den Fachmann ohne besondere Überlegungen aufgrund seines Fachwissens auffindbar gewesen sein. Ähnlich wie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Patentprüfungsverfahren kann dabei der Stand der Technik zum Zeitpunkt des Patents berücksichtigt werden. Offenbart der Stand der Technik zum Beispiel, dass auch Niete zur Verbindung der beiden Bauteile an Stelle von Schweißpunkten in ähnlichen Vorrichtungen zum Einsatz kommen, so kann dies für ein Naheliegen des abgewandelten Merkmals in Form der Niete sprechen.
Könnte allein die Feststellung von „Gleichwirkung“ und „Naheliegen“ eine äquivalente Benutzung begründen, so würde dies zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit auf Seiten Dritter führen, die nicht mehr klar erkennen können, ob ihre Benutzungshandlung in den Schutzbereich des Patents fällt oder nicht. Aus diesem Grunde muss abschließend auch noch die „Gleichwertigkeit“ des abgewandelten Merkmals festgestellt werden. Hierbei orientiert man sich wieder verstärkt an dem Sinngehalt des Patentanspruchs und der Patentschrift allein.
Führt das Studium der Patentschrift allein zu dem Schluss, dass das abgewandelte Merkmal gerade nicht von dem Patent erfasst werden sollte, muss eine Gleichwertigkeit verneint werden. Ist in der Patentschrift zum Beispiel ein Stand der Technik diskutiert, bei dem die zuvor genannten Niete zum Verbinden der beiden Bauteile verwendet werden, der Patentanspruch aber dennoch auf Schweißpunkte zur Verbindung gerichtet ist, so sollten Niete offensichtlich nicht vom Schutzbereich erfasst werden. Auch wenn in der Patentschrift beispielsweise jedwede Hinweise auf Vorteile der Schweißpunkte fehlen und diese dennoch in den Patentanspruch eingeflossen sind, so kann von einer fehlenden Gleichwertigkeit bei der Verwendung der Niete ausgegangen werden.
Unterschied zwischen Landgericht und Einheitspatentgericht
Das dargestellte Prüfungsschema zur Prüfung einer äquivalenten Benutzung eines Patents hat sich bewährt und kann durchaus als Ausfluss deutscher Gründlichkeit bezeichnet werden, allerdings wird dieses Prüfungsschema nicht auch zwingend in anderen Ländern oder Jurisdiktionen so gehandhabt. So ist beispielsweise aufgrund erster Entscheidungen des noch relativ jungen Einheitspatentgerichts ersichtlich, dass der deutsche Ansatz mit Ansätzen aus dem europäischen Ausland vermengt wird, zugunsten einer eher funktionsorientierten Beurteilung abgewandelter Merkmale. Insoweit können Einheitspatente, die ihre Wirkung auch in Deutschland entfalten, und deutsche Patente mit Blick auf eine äquivalente Benutzung vom Einheitspatentgericht und deutschem Landgericht durchaus unterschiedlich beurteilt werden.